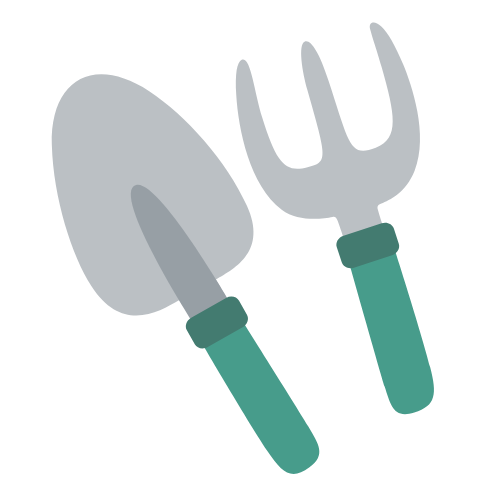Kompost ist im Grunde genommen der Prozess, bei dem organische Materialien durch Mikroorganismen, Pilze und Kleinstlebewesen zersetzt und in nährstoffreichen Humus umgewandelt werden. Die Betrachtung dieses Themas kann aus verschiedenen Blickwinkeln erfolgen: Für Hobbygärtner ist es eine kostengünstige Methode, um Gartenabfälle zu verwerten und eigenen Dünger herzustellen. Aus ökologischer Sicht reduziert Kompostierung Müll und schließt Nährstoffkreisläufe. Für Wissenschaftler wiederum ist es ein faszinierendes mikrobiologisches Ökosystem.
In den folgenden Abschnitten nehme ich dich mit auf eine Reise durch die Welt der Kompostierung. Du erfährst, welche Materialien sich eignen, wie du deinen eigenen Komposthaufen anlegst und pflegst, welche Prozesse dabei ablaufen und wie du den fertigen Kompost optimal nutzen kannst. Mit praktischen Tipps, Fehlerbehebungen und kreativen Ideen wirst du zum Kompost-Experten – bereit, das „schwarze Gold“ für deinen Garten zu gewinnen.
Die Grundlagen der Kompostierung
Die Natur kennt keine Abfälle – was in einem Kreislauf abgestorben ist, wird zur Nahrungsgrundlage für neues Leben. Genau dieses Prinzip machen wir uns bei der Kompostierung zunutze. Der Prozess selbst ist ein Wunderwerk der Natur, bei dem unzählige Organismen zusammenarbeiten.
Was genau ist Kompost?
Bei der Kompostierung handelt es sich um einen biologischen Abbauvorgang, bei dem organische Materialien durch verschiedene Lebewesen zersetzt und in wertvollen Humus umgewandelt werden. Dieser Prozess findet in der Natur ständig statt – denken wir nur an den Waldboden, wo abgefallene Blätter und Äste langsam verrotten und neue Nährstoffe für die Vegetation bereitstellen.
In einem gut angelegten Komposthaufen beschleunigen wir diesen natürlichen Prozess, indem wir optimale Bedingungen für die Zersetzungsorganismen schaffen. Das Endprodukt ist ein krümeliger, dunkler Humus, der reich an Nährstoffen und Mikroorganismen ist – daher auch die Bezeichnung „schwarzes Gold“.
„Kompost ist nicht einfach nur ein Dünger – er ist ein lebendiges Ökosystem, das den Boden mit allem versorgt, was Pflanzen für gesundes Wachstum benötigen.“
Die Vorteile der Kompostierung
Die Herstellung eigenen Komposts bringt zahlreiche Vorteile mit sich:
🌱 Natürliche Düngung ohne Chemie – schont Umwelt und Geldbeutel
🍎 Sinnvolle Verwertung von Küchen- und Gartenabfällen
🌍 Reduzierung des Müllaufkommens und der Transportwege
🌿 Förderung der Bodengesundheit und Biodiversität
🌷 Verbesserung der Bodenstruktur und Wasserspeicherfähigkeit
Durch die Verwendung von selbst hergestelltem Kompost schließt du den Nährstoffkreislauf in deinem Garten. Die Pflanzen nehmen Nährstoffe auf, wir ernten und genießen die Früchte, und die nicht verwertbaren Teile geben durch Kompostierung die Nährstoffe wieder an den Boden zurück. Ein perfektes Beispiel für Nachhaltigkeit im eigenen Garten!
Die Biologie hinter der Kompostierung
Der Komposthaufen ist ein komplexes Ökosystem, in dem verschiedene Organismen in einer bestimmten Reihenfolge und in Abhängigkeit voneinander arbeiten. Diese Lebewesen lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen:
- Mikroorganismen: Bakterien und Pilze beginnen mit der Zersetzung und sind für den größten Teil des Abbaus verantwortlich.
- Mesofauna: Kleine Tierchen wie Springschwänze, Milben und Fadenwürmer zerkleinern das Material weiter und fressen Bakterien und Pilze.
- Makrofauna: Größere Tiere wie Regenwürmer, Asseln, Tausendfüßer und verschiedene Insektenlarven bearbeiten gröberes Material und durchmischen den Kompost.
Die Aktivität dieser Organismen erzeugt Wärme – ein gut arbeitender Komposthaufen kann im Inneren Temperaturen von 50-70°C erreichen. Diese Hitze beschleunigt nicht nur den Abbauprozess, sondern tötet auch Krankheitserreger und Unkrautsamen ab.
Der perfekte Standort und die richtige Anlage

Die Wahl des richtigen Standorts und die korrekte Anlage sind entscheidend für einen erfolgreichen Kompostierungsprozess.
Den idealen Platz finden
Für deinen Komposthaufen solltest du einen Platz wählen, der folgende Kriterien erfüllt:
- Halbschattig: Direkte Sonneneinstrahlung kann den Kompost austrocknen, während zu viel Schatten den Prozess verlangsamt.
- Windgeschützt: Starker Wind trocknet den Kompost aus.
- Direkter Bodenkontakt: Ermöglicht Bodenorganismen den Zugang zum Kompost.
- Gute Erreichbarkeit: Du solltest den Kompost bequem mit der Schubkarre erreichen können.
- Angemessener Abstand: Halte aus Rücksicht auf Nachbarn einen gewissen Abstand zur Grundstücksgrenze ein.
Ein Platz unter einem laubabwerfenden Baum ist oft ideal – im Sommer spendet er Schatten, im Winter lässt er Licht und Wärme durch. Vermeide aber Standorte unter Nadelbäumen, da deren saures Laub den pH-Wert des Komposts negativ beeinflussen kann.
Kompostsysteme im Vergleich
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Kompost anzulegen:
Offener Komposthaufen
- Einfach anzulegen und zu pflegen
- Gute Belüftung und natürlicher Zugang für Bodenorganismen
- Benötigt mehr Platz und kann unordentlich wirken
- Anfälliger für Witterungseinflüsse und ungebetene Gäste
Kompostbehälter aus Holz
- Klassische Variante mit guter Optik
- Lässt sich gut in den Garten integrieren
- Bietet Schutz vor Witterung und Tieren
- Holz ist natürlich, verrottet aber mit der Zeit
Kunststoff-Komposter
- Platzsparend und oft mit Deckel
- Gute Wärmeisolierung
- Weniger ästhetisch, aber praktisch
- Oft mit Entnahmeklappe für fertigen Kompost
Thermo-Komposter
- Besonders gute Wärmeisolierung für schnelle Kompostierung
- Geschlossenes System mit wenig Geruchsentwicklung
- Höherer Anschaffungspreis
- Weniger Zugang für natürliche Helfer
Wurmkomposter
- Ideal für Wohnungen oder kleine Gärten
- Verarbeitet hauptsächlich Küchenabfälle
- Produziert besonders wertvollen Wurmhumus
- Benötigt spezielle Pflege der Kompostwürmer
Die Wahl des Systems hängt von deinem Platzangebot, der anfallenden Menge an Kompostmaterial und deinen ästhetischen Vorlieben ab.
Den Kompost richtig anlegen
Beim Anlegen eines neuen Komposthaufens solltest du systematisch vorgehen:
- Bodenvorbereitung: Lockere den Boden unter dem geplanten Kompost auf, um den Zugang für Bodenorganismen zu erleichtern.
- Erste Schicht: Beginne mit einer 10-15 cm dicken Schicht aus grobem Material wie Zweigen oder Häckselgut. Diese sorgt für Drainage und Belüftung von unten.
- Schichtung: Wechsle nun zwischen stickstoffreichen (grünen) und kohlenstoffreichen (braunen) Materialien ab. Halte dabei ein ungefähres Verhältnis von 1:3 (grün:braun) ein.
- Starterhilfe: Gib etwas reifen Kompost oder spezielle Kompoststarter hinzu, um den Prozess zu beschleunigen.
- Abdeckung: Decke den Haufen mit einer dünnen Schicht Erde, Stroh oder einem speziellen Kompostvlies ab, um Austrocknung und Nährstoffverluste zu vermeiden.
Ein gut angelegter Kompost sollte feucht, aber nicht nass sein – vergleichbar mit einem ausgedrückten Schwamm. Bei zu viel Nässe droht Fäulnis und Sauerstoffmangel, bei zu wenig Feuchtigkeit kommt der Abbauprozess zum Erliegen.
Die richtigen Materialien für guten Kompost

Die Auswahl der Materialien ist entscheidend für den Erfolg deiner Kompostierung. Dabei gilt es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen stickstoff- und kohlenstoffreichen Materialien zu finden.
Was darf auf den Kompost?
Stickstoffreiche (grüne) Materialien:
- Frische Pflanzenreste aus dem Garten
- Rasenschnitt (in dünnen Schichten)
- Gemüse- und Obstabfälle aus der Küche
- Kaffeesatz und Teebeutel (ohne Metallklammern)
- Eierschalen (zerkleinert)
- Schnittblumen
- Gesunde Unkräuter (ohne Samen)
Kohlenstoffreiche (braune) Materialien:
- Laub
- Stroh
- Sägemehl und Hobelspäne (unbehandelt)
- Zerkleinerte Zweige und Äste
- Papier und Karton (unbedruckt, zerkleinert)
- Trockeneres Pflanzenmaterial
- Heckenschnitt (zerkleinert)
Die braunen Materialien liefern Struktur und Energie für die Kompostorganismen, während die grünen Materialien Stickstoff für deren Wachstum bereitstellen. Ein ausgewogenes Verhältnis sorgt für optimale Abbauprozesse.
Was gehört nicht auf den Kompost?
Einige Materialien sollten nicht kompostiert werden, da sie problematisch sein können:
- Gekochte Speisereste (locken Schädlinge an)
- Fleisch, Fisch, Knochen (Geruchsentwicklung, Schädlinge)
- Milchprodukte (Geruchsentwicklung)
- Kranke Pflanzenteile (Krankheitsübertragung)
- Hartnäckige Unkräuter wie Quecke oder Winde
- Katzenstreu und Hundekot
- Zitrusfrüchte und Bananenschalen in großen Mengen (Pestizide, langsame Zersetzung)
- Asche von Kohle oder behandeltem Holz
- Straßenkehricht
- Staubsaugerbeutelinhalt
- Zeitschriften und bedrucktes Papier
„Ein guter Kompost ist wie eine ausgewogene Mahlzeit für den Boden – mit allen Nährstoffen, die für ein gesundes Pflanzenwachstum notwendig sind.“
Materialien optimal vorbereiten
Die richtige Vorbereitung der Kompostmaterialien kann den Zersetzungsprozess erheblich beschleunigen:
- Zerkleinern: Je kleiner die Materialien, desto größer die Angriffsfläche für Mikroorganismen. Holzige Teile solltest du häckseln, große Blätter zerreißen.
- Mischen: Vermische stickstoff- und kohlenstoffreiche Materialien gut miteinander, anstatt sie in dicken Schichten aufeinanderzulegen.
- Anwelken lassen: Sehr feuchtes Material wie Rasenschnitt sollte vor dem Kompostieren etwas antrocknen, um Fäulnis zu vermeiden.
- Zerdrücken: Eierschalen solltest du zerkleinern, um die Zersetzung zu beschleunigen.
- Entfernen: Plastikteile, Etiketten und andere Fremdkörper müssen vor dem Kompostieren entfernt werden.
Eine gute Faustregel ist: Je härter und größer ein Material, desto länger dauert die Zersetzung. Ein gut vorbereiteter Kompost mit kleinen Teilchen reift schneller und gleichmäßiger.
Die Kompostpflege im Jahresverlauf
Ein gesunder Kompost benötigt regelmäßige, aber nicht übermäßige Pflege. Die Intensität der Pflege variiert je nach Jahreszeit.
Frühling: Start in die Gartensaison
Der Frühling ist die perfekte Zeit, um den Winterkompost zu überprüfen und für die neue Gartensaison vorzubereiten:
- Umsetzen des Winterkomposts: Setze den über Winter angesammelten Kompost um, um ihn mit Sauerstoff anzureichern und den Abbauprozess zu beschleunigen.
- Verwendung des reifen Komposts: Fertiger Kompost kann jetzt als Dünger für Beete und Töpfe verwendet werden, bevor die Hauptwachstumsphase beginnt.
- Neuen Kompost anlegen: Starte einen frischen Komposthaufen für die kommende Gartensaison.
- Frühjahrsschnitt kompostieren: Verarbeite den Rückschnitt von Stauden und Sträuchern durch gutes Zerkleinern.
Im Frühling erwachen auch die Kompostorganismen aus ihrer Winterruhe und werden bei steigenden Temperaturen wieder aktiver.
Sommer: Zeit der Fülle
Im Sommer fallen besonders viele Gartenabfälle an, und der Kompost arbeitet auf Hochtouren:
- Feuchtigkeit kontrollieren: Bei Hitze und Trockenheit musst du den Kompost gelegentlich gießen, um die Aktivität der Mikroorganismen aufrechtzuerhalten.
- Rasenschnitt richtig einbringen: Verteile Rasenschnitt nur in dünnen Schichten und lasse ihn vorher anwelken, um Fäulnis zu vermeiden.
- Abdeckung bei Hitze: Bei anhaltender Hitze kann eine leichte Abdeckung mit Stroh oder Kompostvlies sinnvoll sein, um Austrocknung zu vermeiden.
- Regelmäßiges Umsetzen: Bei hohen Temperaturen laufen die Abbauprozesse schneller ab – ein Umsetzen alle 4-6 Wochen ist ideal.
Herbst: Zeit der Ernte und Vorbereitung
Der Herbst bringt eine Fülle an Kompostmaterial und ist die Hauptsaison für die Kompostpflege:
- Laubkompostierung: Laub ist ein wertvolles Kompostmaterial, sollte aber mit stickstoffreicheren Materialien gemischt werden. Sehr große Mengen kannst du auch separat als Laubkompost ansetzen.
- Ernte des Sommerkomposts: Der im Frühling angesetzte Kompost ist oft im Herbst reif und kann geerntet werden.
- Wintervorbereitung: Bereite den Kompost auf den Winter vor, indem du ihn noch einmal gründlich umsetzt und bei Bedarf abdeckst.
- Obstabfälle verarbeiten: Die Reste der Obsternte eignen sich hervorragend für den Kompost.
Winter: Zeit der Ruhe
Im Winter verlangsamen sich die Abbauprozesse, aber sie kommen nicht vollständig zum Erliegen:
- Isolierung: Eine Abdeckung mit Stroh, Laub oder speziellem Kompostvlies schützt vor zu starker Auskühlung.
- Küchenabfälle sammeln: Auch im Winter können Küchenabfälle auf den Kompost, am besten in die Mitte des Haufens, wo es wärmer ist.
- Seltenes Umsetzen: Im Winter ist ein Umsetzen meist nicht nötig und kann sogar kontraproduktiv sein, da es die gespeicherte Wärme freisetzen würde.
- Planung: Nutze die ruhigere Gartenzeit, um die Kompostierung für das kommende Jahr zu planen.
| Jahreszeit | Hauptaktivitäten | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Frühling | Umsetzen, Verwenden des reifen Komposts, Neuen Kompost anlegen | Steigende biologische Aktivität |
| Sommer | Feuchtigkeit kontrollieren, Rasenschnitt einbringen, Regelmäßiges Umsetzen | Hohe Abbaugeschwindigkeit, Gefahr der Austrocknung |
| Herbst | Laubkompostierung, Ernte des Sommerkomposts, Wintervorbereitung | Große Materialmengen, ideale Zeit zum Umsetzen |
| Winter | Isolierung, Küchenabfälle in die Mitte geben, Planung | Verlangsamte Abbauprozesse, Schutz vor Kälte |
Der Kompostierungsprozess im Detail

Die Umwandlung von organischen Abfällen zu wertvollem Humus ist ein faszinierender Prozess, der in mehreren Phasen abläuft.
Die verschiedenen Phasen der Kompostierung
Der Kompostierungsprozess durchläuft typischerweise drei Hauptphasen:
1. Abbauphase (Wochen 1-4)
In dieser ersten Phase beginnen Mikroorganismen mit dem Abbau leicht zersetzbarer Substanzen. Die Temperatur im Komposthaufen steigt durch die intensive mikrobielle Aktivität auf 50-70°C an. Diese Hitze ist wichtig, da sie Krankheitserreger und Unkrautsamen abtötet. Das Material verliert an Volumen und sackt zusammen.
2. Umbauphase (Wochen 5-12)
Die Temperatur sinkt allmählich, und andere Organismengruppen übernehmen die Arbeit. Pilze bauen nun auch schwerer zersetzbare Stoffe wie Zellulose ab. Regenwürmer, Asseln und andere größere Organismen wandern ein und zerkleinern das Material weiter. In dieser Phase riecht der Kompost bereits erdig.
3. Aufbauphase (ab Woche 13)
In der letzten Phase entstehen stabile Humusverbindungen. Die Temperatur gleicht sich der Umgebungstemperatur an. Regenwürmer spielen nun eine Hauptrolle und durchmischen den Kompost vollständig. Das Material wird dunkler und bekommt eine krümelige Struktur.
„Ein reifer Kompost ist wie ein guter Wein – er braucht Zeit, um sein volles Potenzial zu entfalten. Wer Geduld hat, wird mit einem lebendigen, nährstoffreichen Bodenverbesserer belohnt.“
Faktoren, die den Prozess beeinflussen
Verschiedene Faktoren haben Einfluss auf die Geschwindigkeit und Qualität der Kompostierung:
Feuchtigkeit
Der Wassergehalt sollte bei etwa 50-60% liegen – vergleichbar mit einem ausgedrückten Schwamm. Zu viel Wasser führt zu Sauerstoffmangel und Fäulnis, zu wenig verlangsamt den Abbauprozess.
Sauerstoffversorgung
Kompostierung ist ein aerober Prozess, der Sauerstoff benötigt. Regelmäßiges Umsetzen oder eine gute Strukturierung mit grobem Material sorgt für ausreichende Belüftung.
Temperatur
Die optimale Temperatur für die mikrobielle Aktivität liegt zwischen 50-60°C in der Abbauphase. Im Winter verlangsamt sich der Prozess, kommt aber nicht vollständig zum Erliegen.
C:N-Verhältnis
Das ideale Verhältnis zwischen Kohlenstoff und Stickstoff liegt bei etwa 25-30:1. Ein zu hoher Kohlenstoffanteil verlangsamt den Prozess, zu viel Stickstoff führt zu Ammoniakbildung und unangenehmen Gerüchen.
pH-Wert
Der optimale pH-Wert für die Kompostierung liegt im leicht sauren bis neutralen Bereich (6,5-8). Er reguliert sich meist von selbst, kann aber bei Bedarf durch Zugabe von Gesteinsmehl oder Kalk beeinflusst werden.
Woran erkenne ich reifen Kompost?
Reifer Kompost hat charakteristische Eigenschaften, an denen du erkennen kannst, dass er verwendungsbereit ist:
- Aussehen: Dunkelbraun bis schwarz, krümelige Struktur
- Geruch: Angenehm erdig, nach Waldboden
- Konsistenz: Locker und krümelig, keine erkennbaren Ausgangsmaterialien mehr (außer sehr holzigen Teilen)
- Temperatur: Keine Eigenerwärmung mehr, Temperatur entspricht der Umgebungstemperatur
- Bewohner: Viele Regenwürmer und andere größere Bodenorganismen
Ein einfacher Test ist die Kresseprobe: Säe Kressesamen auf einer kleinen Probe deines Komposts aus. Keimen die Samen schnell und wachsen die Pflänzchen kräftig und grün, ist der Kompost reif und frei von wachstumshemmenden Substanzen.
Die Verwendung von fertigem Kompost
Der fertige Kompost ist ein wertvoller Schatz für deinen Garten und kann vielseitig eingesetzt werden.
Einsatzbereiche im Garten
Fertiger Kompost kann auf verschiedene Weise im Garten genutzt werden:
Als Bodendünger
Verteile eine 1-3 cm dicke Schicht Kompost auf Beeten und arbeite sie leicht in die obere Bodenschicht ein. Dies verbessert die Bodenstruktur und versorgt Pflanzen mit Nährstoffen.
Als Mulchmaterial
Eine dünne Schicht Kompost als Mulch schützt den Boden vor Austrocknung, unterdrückt Unkrautwuchs und gibt langsam Nährstoffe ab.
Für Pflanzlöcher
Beim Einpflanzen von Stauden, Sträuchern oder Bäumen kannst du dem Pflanzloch etwa 20-30% Kompost beimischen, um den Start zu erleichtern.
Für Rasenanlage und -pflege
Vor der Rasenaussaat verbessert eine dünne Kompostschicht den Boden. Bestehende Rasenflächen profitieren von einer jährlichen Kompostgabe (max. 1 cm) im Frühjahr.
Für Topf- und Kübelpflanzen
Mische Kompost mit Gartenerde und Sand oder Perlite für hochwertige Topferde. Verwende für Topfpflanzen nur vollständig ausgereiften, gesiebten Kompost.
Dosierung und Anwendungszeitpunkt
Die richtige Dosierung ist wichtig, um Überdüngung zu vermeiden:
| Pflanzenart | Menge pro m² | Bester Anwendungszeitpunkt |
|---|---|---|
| Gemüsebeete | 3-5 Liter | Frühjahr vor der Aussaat/Pflanzung |
| Stauden | 2-3 Liter | Frühjahr oder Herbst |
| Obstgehölze | 3-4 Liter | Herbst im Kronenbereich |
| Rosen | 3-4 Liter | Frühjahr nach dem Rückschnitt |
| Rasen | max. 1 Liter (gesiebt) | Frühjahr nach dem ersten Schnitt |
| Beerensträucher | 2-3 Liter | Frühjahr oder nach der Ernte |
Bei der Anwendung gilt: Weniger ist oft mehr. Kompost ist kein Kunstdünger, sondern wirkt langsam und nachhaltig. Eine Überdüngung kann zu übermäßigem Wachstum, erhöhter Krankheitsanfälligkeit und Auswaschung von Nährstoffen ins Grundwasser führen.
Spezielle Anwendungen und Kompostprodukte
Neben der direkten Verwendung im Garten kannst du aus deinem Kompost auch spezielle Produkte herstellen:
Komposttee
Ein nährstoffreicher Flüssigdünger, der durch Einweichen von reifem Kompost in Wasser hergestellt wird. Fülle dazu ein Säckchen mit Kompost und hänge es für 24-48 Stunden in einen Eimer mit Wasser. Der entstehende „Tee“ kann verdünnt (1:10) zum Gießen oder als Blattdünger verwendet werden.
Komposterde für Aussaaten
Für Aussaaten eignet sich fein gesiebter, vollständig ausgereifter Kompost, gemischt mit Sand und etwas Gartenerde im Verhältnis 1:1:1.
Kompost als Rasendünger
Fein gesiebter Kompost eignet sich hervorragend zur Rasenpflege. Er kann im Frühjahr dünn auf dem Rasen verteilt werden und verbessert die Bodenstruktur.
„Kompost ist mehr als nur ein Dünger – er ist ein Bodenverbesserer, der die gesamte Struktur und Biologie des Bodens positiv beeinflusst und dadurch langfristig gesunde Pflanzen fördert.“
Häufige Probleme und ihre Lösungen

Auch bei sorgfältiger Pflege können bei der Kompostierung gelegentlich Probleme auftreten. Die meisten lassen sich jedoch leicht beheben.
Unangenehme Gerüche
Wenn dein Kompost unangenehm riecht, liegt meist eines dieser Probleme vor:
Problem: Fauliger Geruch
Ursache: Zu viel Feuchtigkeit und zu wenig Sauerstoff führen zu Fäulnisprozessen.
Lösung: Kompost umsetzen und dabei trockenes, strukturreiches Material wie Stroh, Zweige oder trockenes Laub untermischen. Bei starkem Regen den Kompost abdecken.
Problem: Ammoniakgeruch
Ursache: Zu viel stickstoffreiches Material (z.B. Rasenschnitt, frische Pflanzenreste).
Lösung: Kohlenstoffreiche Materialien wie Stroh, Laub oder Papierschnipsel untermischen, um das C:N-Verhältnis zu verbessern.
Schädlinge und unerwünschte Besucher
Einige Tiere im Kompost sind nützliche Helfer, andere können problematisch sein:
Problem: Ratten
Ursache: Meist angelockt durch Speisereste, besonders Fleisch, Fisch oder gekochte Essensreste.
Lösung: Keine tierischen Produkte oder gekochte Speisen kompostieren. Den Kompost regelmäßig umsetzen. Eventuell einen geschlossenen Komposter verwenden.
Problem: Fruchtfliegen
Ursache: Frische Obst- und Gemüseabfälle an der Oberfläche.
Lösung: Küchenabfälle immer mit einer Schicht Erde, Laub oder Stroh abdecken. Einen Deckel für den Küchenabfalleimer verwenden.
Problem: Ameisen
Ursache: Ameisen siedeln sich gerne in trockenen Komposthaufen an.
Lösung: Den Kompost feuchter halten und regelmäßig umsetzen. Ameisen sind übrigens nicht schädlich für den Kompost, sondern lockern ihn sogar auf.
Der Kompost wird nicht heiß
Ein häufiges Problem ist, dass der Kompost nicht die erwartete Hitze entwickelt:
Ursachen:
- Zu geringe Menge (ein Komposthaufen sollte mindestens 1 m³ groß sein)
- Zu trocken oder zu nass
- Ungünstiges C:N-Verhältnis
- Zu kalte Außentemperaturen
Lösungen:
- Mehr Material sammeln oder den bestehenden Kompost in einen kleineren Behälter umschichten
- Bei Trockenheit wässern, bei zu viel Nässe trockenes Material einmischen
- Das Verhältnis von grünen zu braunen Materialien anpassen
- Im Winter den Kompost isolieren oder bis zum Frühjahr warten
Langsame Zersetzung
Wenn sich dein Kompostmaterial nur sehr langsam zersetzt, können folgende Faktoren die Ursache sein:
Ursachen:
- Zu große Materialstücke
- Zu viel holziges Material
- Zu trocken
- Zu kalt
- Mangel an Stickstoff
Lösungen:
- Material zerkleinern, besonders holzige Teile häckseln
- Mehr stickstoffreiche Materialien hinzufügen
- Für ausreichende Feuchtigkeit sorgen
- Kompost umsetzen, um die Aktivität anzuregen
- Kompoststarter oder etwas reifen Kompost hinzufügen
„Probleme im Kompost sind wie kleine Rätsel – sie geben uns Hinweise darauf, was im verborgenen Ökosystem nicht im Gleichgewicht ist. Wer diese Zeichen zu lesen lernt, wird zum Meister der Kompostierung.“
Spezielle Kompostierungsmethoden

Neben der klassischen Kompostierung gibt es verschiedene Spezialmethoden, die für bestimmte Situationen oder Anforderungen besonders geeignet sind.
Bokashi – Fermentation statt Verrottung
Bokashi ist eine aus Japan stammende Methode, bei der organische Abfälle nicht kompostiert, sondern fermentiert werden:
Funktionsweise:
- Organische Abfälle werden in einem luftdichten Behälter mit speziellen Mikroorganismen (EM = Effektive Mikroorganismen) versetzt
- Durch anaerobe Fermentation entstehen Milchsäurebakterien, die das Material konservieren
- Das fermentierte Material kann nach 2-4 Wochen in den Boden eingearbeitet werden
Vorteile:
- Platzsparend, auch für Wohnungen geeignet
- Geruchsarm
- Schneller als klassische Kompostierung
- Auch für Speisereste mit Fleisch und Fisch geeignet
Nachteile:
- Benötigt spezielle Bokashi-Eimer und EM-Präparate
- Fermentiertes Material muss noch in die Erde eingearbeitet werden
- Etwas höhere Kosten
Wurmkompostierung
Die Wurmkompostierung (Vermikompostierung) nutzt spezielle Kompostwürmer, um organische Abfälle zu verarbeiten:
Funktionsweise:
- Spezielle Kompostwürmer (meist Eisenia fetida, Eisenia andrei) verarbeiten organische Abfälle
- Die Würmer fressen täglich etwa ihr eigenes Gewicht an Material
- Wurmkot (Wurmhumus) ist besonders nährstoffreich und pflanzenverfügbar
Vorteile:
- Funktioniert auch in der Wohnung oder auf dem Balkon
- Besonders hochwertiger, nährstoffreicher Wurmhumus
- Ganzjährig möglich
- Geringe Geruchsentwicklung bei richtiger Handhabung
Nachteile:
- Benötigt spezielle Wurmkomposter
- Kompostwürmer müssen gepflegt werden (richtige Temperatur, Feuchtigkeit)
- Nicht für alle Küchenabfälle geeignet (keine Zitrusfrüchte, Zwiebeln, Knoblauch)
Heißkompostierung
Bei der Heißkompostierung wird der natürliche Erwärmungsprozess gezielt gefördert und genutzt:
Funktionsweise:
- Große Menge Material (mind. 1 m³) wird auf einmal aufgesetzt
- Optimales C:N-Verhältnis von etwa 25-30:1 wird angestrebt
- Durch intensive mikrobielle Aktivität steigt die Temperatur auf 60-70°C
- Regelmäßiges Umsetzen hält den Prozess in Gang
Vorteile:
- Sehr schnelle Kompostierung (6-12 Wochen)
- Abtötung von Krankheitserregern und Unkrautsamen durch hohe Temperaturen
- Auch für problematischere Materialien geeignet
Nachteile:
- Benötigt größere Materialmengen auf einmal
- Arbeitsintensiver durch häufigeres Umsetzen
- Höherer Platzbedarf
Laubkompostierung
Speziell für große Mengen Herbstlaub eignet sich die separate Laubkompostierung:
Funktionsweise:
- Laub wird separat gesammelt und kompostiert
- Durch Zugabe von Stickstoff (z.B. Hornspäne, Rasenschnitt) wird der Abbauprozess beschleunigt
- Alternativ kann Laub auch in Säcken oder einem Drahtkorb gelagert werden
Vorteile:
- Verwertung großer Laubmengen
- Entstehung von wertvollem Laubkompost oder Lauberde
- Entlastung des Hauptkomposts
Nachteile:
- Langsamer Abbauprozess (1-2 Jahre)
- Manche Laubarten (Eiche, Walnuss) enthalten Gerbstoffe, die den Abbau verlangsamen
„Jede Kompostierungsmethode ist wie ein eigenes kleines Ökosystem mit seinen eigenen Regeln. Die Kunst liegt darin, die Methode zu finden, die zu deinen Bedürfnissen und deinem Lebensstil passt.“
Kompost im Kontext nachhaltiger Gartenpraxis

Die Kompostierung ist nicht nur eine praktische Methode zur Abfallverwertung, sondern ein zentrales Element nachhaltiger Gartenpraxis.
Kreislaufwirtschaft im eigenen Garten
Kompostierung ist ein perfektes Beispiel für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft im kleinen Maßstab:
- Nährstoffkreislauf: Pflanzen nehmen Nährstoffe aus dem Boden auf, wir ernten und nutzen die Pflanzen, und durch Kompostierung führen wir die Nährstoffe wieder dem Boden zu.
- Abfallvermeidung: Garten- und Küchenabfälle werden nicht als Müll betrachtet, sondern als wertvolle Ressource.
- Energieeffizienz: Durch die Nutzung eigenen Komposts entfallen Produktion, Verpackung und Transport von Düngemitteln.
- Wassermanagement: Kompostierter Boden speichert Wasser besser und reduziert den Bewässerungsbedarf.
Diese Kreislaufprinzipien können im gesamten Garten angewendet werden, vom Mulchen mit Rasenschnitt bis zum Einarbeiten von Gründüngungspflanzen.
Kompost und Klimaschutz
Kompostierung kann einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten:
- CO₂-Bindung: Humus bindet Kohlenstoff im Boden und entzieht ihn so der Atmosphäre.
- Vermeidung von Methanemissionen: Bei der aeroben Kompostierung entstehen weniger Methanemissionen als bei der anaeroben Zersetzung organischer Materialien auf Deponien.
- Reduzierte Transportwege: Selbsthergestellter Kompost ersetzt zugekaufte Erden und Dünger, was Transportemissionen einspart.
- Verbesserung der Bodengesundheit: Gesunde, humusreiche Böden sind widerstandsfähiger gegen Klimaextreme wie Dürre und Starkregen.
Kompost und Biodiversität
Ein gesunder Kompost fördert die Biodiversität auf mehreren Ebenen:
- Mikrobielles Leben: Im Kompost leben Milliarden von Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen, die für gesunde Böden unerlässlich sind.
- Bodenfauna: Regenwürmer, Asseln, Tausendfüßer und viele andere Bodentiere finden im Kompost Nahrung und Lebensraum.
- Pflanzenvielfalt: Mit Kompost verbesserter Boden ermöglicht den Anbau einer größeren Vielfalt an Pflanzen, was wiederum mehr Insekten und Vögel anzieht.
- Ökologisches Gleichgewicht: Ein gesunder, biologisch aktiver Boden reguliert sich weitgehend selbst und reduziert Probleme mit Schädlingen und Krankheiten.
Der Komposthaufen selbst kann zudem als Überwinterungsquartier für Igel, Kröten und andere nützliche Gartenbewohner dienen.
Kompost in verschiedenen Gartenkontexten
Je nach Gartengröße, Lage und persönlichen Vorlieben kann die Kompostierung unterschiedlich gestaltet werden.
Kompostieren im Kleingarten
In Kleingärten mit begrenztem Platz sind platzsparende Lösungen gefragt:
- Kompakte Komposter: Fertigkomposter aus Kunststoff oder Metall nehmen wenig Platz ein und bieten dennoch ausreichend Volumen.
- Stapelbare Systeme: Modulare Kompostsysteme können je nach Bedarf erweitert oder verkleinert werden.
- Integration in Beete: In Permakultur-inspirierten Gärten können kleine Kompostbereiche direkt in Hochbeete oder zwischen Sträucher integriert werden.
- Gemeinschaftskompostierung: In Kleingartenanlagen bietet sich oft eine gemeinschaftliche Kompostanlage an, die von mehreren Gärtnern genutzt wird.
Wichtig ist in Kleingärten besonders die ordentliche und geruchsarme Kompostierung, um Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden.
Kompostieren auf Balkon und Terrasse
Auch ohne Garten muss man nicht auf Kompostierung verzichten:
- Wurmkomposter: Speziell für Balkone und Wohnungen entwickelte Wurmkomposter verarbeiten Küchenabfälle platzsparend und geruchsarm.
- Bokashi-System: Die Fermentation im geschlossenen Bokashi-Eimer eignet sich hervorragend für Wohnungen und Balkone.
- Mini-Komposter: Es gibt spezielle kleine Komposter für Balkone, die oft auch dekorativ gestaltet sind.
- Kooperationen: Wer selbst keinen Platz hat, kann oft Vereinbarungen mit Gemeinschaftsgärten oder Nachbarn mit Garten treffen.
Kompostieren im großen Garten
In größeren Gärten bieten sich erweiterte Möglichkeiten:
- Mehrere Kompostplätze: Ein Kompostplatz nahe der Küche für Küchenabfälle und einer im hinteren Gartenbereich für Gartenabfälle.
- Drei-Kammer-System: Ideal ist ein System mit drei Bereichen: einer zum Sammeln frischer Abfälle, einer für reifenden Kompost und einer für fertigen Kompost.
- Spezialkomposte: Separate Komposthaufen für Laub, Rasenschnitt oder holziges Material ermöglichen eine optimale Verarbeitung.
- Integrierte Systeme: Die Kombination von Kompost mit anderen Gartenelementen wie Hochbeeten, Hügelbeeten oder Kräuterspiralen nach Permakultur-Prinzipien.
In größeren Gärten kann die Kompostierung auch stärker in die Gesamtgestaltung einbezogen werden, etwa durch dekorative Umrandungen oder die Einbindung in ein Nutzgartenkonzept.
„Der Kompost ist das schlagende Herz eines lebendigen Gartens – er verbindet alle Elemente und hält den Kreislauf des Lebens in Gang. Wer kompostiert, versteht den tieferen Sinn des Gärtnerns.“
Kompost für Anfänger: Erste Schritte
Für Einsteiger in die Welt der Kompostierung hier eine einfache Anleitung, um erfolgreich zu starten.
Die wichtigsten Grundregeln
Halte dich an diese fünf Grundregeln, und dein erster Kompost wird gelingen:
- Mischen statt Schichten: Mische braune (kohlenstoffreiche) und grüne (stickstoffreiche) Materialien gut durch, anstatt sie in dicken Schichten aufeinanderzulegen.
- Feuchtigkeit wie ein ausgedrückter Schwamm: Der Kompost sollte feucht, aber nicht nass sein. Bei einer Handprobe sollten nur wenige Tropfen zwischen den Fingern herausquellen.
- Kleinschneiden beschleunigt: Je kleiner das Material, desto schneller der Abbau. Besonders holzige Teile sollten zerkleinert werden.
- Belüftung ist wichtig: Sorge für ausreichend Sauerstoff durch strukturgebende Materialien und gelegentliches Umsetzen.
- Geduld haben: Kompostierung braucht Zeit. Rechne mit 6-12 Monaten bis zur Reife, je nach Bedingungen und Jahreszeit.
Einfache Starter-Ausrüstung
Um mit dem Kompostieren zu beginnen, brauchst du nicht viel:
🌱 Komposter oder Platz für einen Komposthaufen
Für Anfänger eignen sich geschlossene Systeme oft besser als offene Haufen. Ein einfacher Komposter aus Holz oder Kunststoff mit etwa 1 m³ Volumen ist ideal.
🍎 Sammelbehälter für die Küche
Ein kleiner Eimer mit Deckel für die Küchenabfälle erleichtert das Sammeln.
🌿 Gartenschere oder Häcksler
Zum Zerkleinern von Zweigen und anderen gröberen Materialien.
🌷 Gartengabel oder Kompoststab
Zum Umsetzen und Durchlüften des Komposts.
🌍 Eventuell Kompoststarter
Für den Anfang kann ein Kompoststarter (erhältlich im Gartenfachhandel) oder etwas reifer Kompost von Freunden hilfreich sein.
Der einfachste Weg zum ersten Kompost
Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen ersten Kompost:
Schritt 1: Standort wählen
Suche einen halbschattigen, windgeschützten Platz mit direktem Bodenkontakt.
Schritt 2: Komposter aufstellen
Stelle deinen Komposter auf oder markiere den Bereich für deinen Komposthaufen.
Schritt 3: Grundlage schaffen
Beginne mit einer 10-15 cm dicken Schicht aus grobem Material wie Zweigen oder Häckselgut für die Drainage und Belüftung.
Schritt 4: Erste Füllung
Sammle verschiedene Materialien und mische sie gut durch, bevor du sie in den Komposter gibst. Achte auf eine gute Mischung aus braunen und grünen Materialien.
Schritt 5: Regelmäßig füllen und pflegen
Füge regelmäßig neue Materialien hinzu und mische sie unter die obere Schicht. Kontrolliere gelegentlich die Feuchtigkeit.
Schritt 6: Nach 3-4 Monaten umsetzen
Setze den Kompost nach einigen Monaten um, indem du ihn komplett in einen anderen Behälter oder an einen anderen Platz umschichtest. Dies bringt Sauerstoff in das Material.
Schritt 7: Reife abwarten
Nach etwa 6-12 Monaten sollte dein erster Kompost reif sein. Er ist dann dunkel, krümelig und riecht angenehm nach Walderde.
Schritt 8: Ernten und verwenden
Siebe den fertigen Kompost bei Bedarf und verwende ihn im Garten.
FAQ zur Kompostierung
Wie lange dauert es, bis Kompost fertig ist?
Die Reifezeit hängt von verschiedenen Faktoren ab: Zusammensetzung des Materials, Witterung, Pflege und Jahreszeit. Im Durchschnitt dauert es etwa 6-12 Monate. Bei optimalen Bedingungen und regelmäßigem Umsetzen kann Kompost auch schon nach 3-4 Monaten reif sein. Im Winter verlangsamt sich der Prozess erheblich.
Kann ich Eierschalen kompostieren?
Ja, Eierschalen können kompostiert werden. Sie sind eine gute Kalziumquelle für den Kompost. Allerdings zersetzen sie sich relativ langsam. Um den Prozess zu beschleunigen, solltest du die Schalen zerkleinern oder zerdrücken, bevor du sie auf den Kompost gibst.
Warum riecht mein Kompost schlecht?
Unangenehme Gerüche entstehen meist durch Sauerstoffmangel und zu viel Feuchtigkeit, was zu Fäulnisprozessen führt. Oder durch ein Ungleichgewicht mit zu vielen stickstoffreichen Materialien. Abhilfe schafft das Umsetzen des Komposts und das Einmischen von strukturgebendem, trockenem Material wie Stroh, Zweigen oder Pappe.
Kann ich Zitrusfrüchte und Bananenschalen kompostieren?
Grundsätzlich ja, aber in Maßen. Zitrusfrüchte enthalten Säuren und ätherische Öle, die in großen Mengen den pH-Wert beeinflussen und Mikroorganismen hemmen können. Bananenschalen können Pestizide enthalten (bei konventionellem Anbau). Beide zersetzen sich zudem relativ langsam. Am besten zerkleinern und nur in kleinen Mengen beimischen.
Wie verhindere ich, dass Ratten meinen Kompost besuchen?
Um Ratten fernzuhalten, solltest du keine gekochten Speisereste, Fleisch, Fisch oder Milchprodukte kompostieren. Verwende einen geschlossenen Komposter mit Boden oder stelle den offenen Kompost auf engmaschigen Draht. Decke frische Küchenabfälle immer mit einer Schicht Gartenabfällen, Erde oder Stroh ab. Regelmäßiges Umsetzen stört ebenfalls potenzielle Nager.
Kann ich im Winter kompostieren?
Ja, die Kompostierung läuft im Winter weiter, allerdings deutlich langsamer. Bei Temperaturen unter 5°C reduziert sich die mikrobielle Aktivität erheblich. Du kannst weiterhin Material hinzufügen, solltest aber auf ein Umsetzen verzichten, um die vorhandene Wärme im Kompost zu halten. Eine Isolierung mit Stroh, Laub oder Kompostvlies kann helfen, die Temperatur zu stabilisieren.